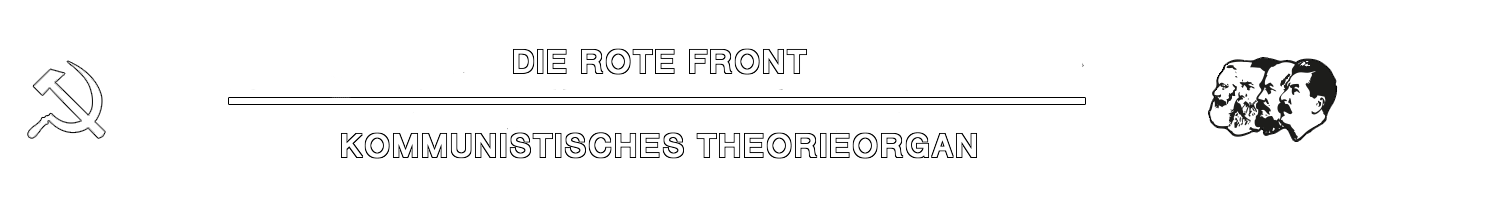Was bleibt von der Religion übrig?
„Man kann nicht elektrisches Licht und Radioapparat benutzen, in Krankheitsfällen moderne medizinische und klinische Mittel in Anspruch nehmen und gleichzeitig an die Geister- und Wunderwelt des Neuen Testaments glauben.“1 – Rudolf Bultmann
Wer kennt nicht dieses berühmte Zitat von Bultmann, welches, wenn man es zu Ende denkt, eigentlich dem Christentum den Atem aushaucht? Er führt dies aber nicht auf die Wissenschaft zurück, sondern das „Selbstverständnis des modernen Menschen“2. Dabei ist dieses „Selbstverständnis“ im Kern wissenschaftsbasiert, denn der Begriff “modern” in sich ist nichtssagend.
Wenn man die Bibel so entmystifiziert, wie Bultmann es tat, dann bleibt nur noch eine ziemlich säkularisierte Theologie übrig, die später zur “Gott ist tot”-Theologie führen würde. Theologie ist nichts anderes als religiös verbrämte Philosophie. Wenn man von ihr noch die übernatürliche Thematik nimmt, ist sie nur noch Philosophie.
Feng Youlan sagte einmal:
„Im Herzen einer jeden großen Religion steckt eine Philosophie. Tatsächlich ist jede große Religion eine Philosophie mit einer bestimmten Menge Überbau, die aus Aberglauben, Dogmen, Ritualen und Institutionen besteht. Das ist es, was ich als Religion bezeichne.“3
Es spielt im Kern keine Rolle, um welche Religion es sich handelt, denn keine Religion kann ihren Wahrheitsgehalt beweisen. Wenn sie es könnte, wäre sie nicht Religion, sondern Wissenschaft. Das einzig über ihren Glaubensgehalt hinaus relevante sind eben ihre aufgeworfenen philosophischen Fragen. Ein Beispiel: Die Frage der Nächstenliebe, die im Neuen Testament im Gleichnis vom Barmherzigen Samariter4 verarbeitet wird, besitzt eine Bedeutung, die über das Christentum hinausreicht. Das ist allein schon dadurch der Fall, weil Samariter aus jüdischer Sicht als Ungläubige gelten. Das Gleichnis zeigt eigentlich auf, dass es auch Ungläubige gibt, die das tun, was die Zehn Gebote eigentlich vorgeben. Damit wird zwar eine theologische Frage abgehandelt, aber das Gleichnis zerstört gleichzeitig das Trugbild, dass Gläubige per se bessere Menschen wären. Und das ist wiederum ein großes philosophisches Problemfeld.
Feng Youlan sagte auch:
„In der Welt der Zukunft wird der Mensch Philosophie statt Religion haben. Das ist konsistent mit der chinesischen Tradition. Es ist nicht nötig, dass ein Mensch religiös ist, aber es ist nötig, dass er philosophisch sein soll. Wenn er philosophisch ist, hat er den besten Segen der Religion.“5
Der Gedanke ist ähnlich wie der, den Mao einmal äußerte:
„Wir kommen ohne Religion aus, aber nicht ohne Glauben.“6
Vielleicht werden die Weltreligionen in Worten weiterbestehen, wenn auch nicht mehr als (mittlerweile ohnehin zumeist inhaltlich entleerte) Massenreligionen, sondern als philosophische Schultraditionen, als Steinbrüche für Gleichnisse und Spruchweisheiten. In China ist dies schon längst der Fall, wie man vor allem an Maos Verwendung konfuzianistischer und daoistischer Referenzen ersehen kann, mit denen er in China allgemein bekannte Sinnbilder beschwor. Würde man Religion, vor allem die Buchreligionen, als Quelle von Weisheit sehen, nicht als Heilslehre, würde sie eine Renaissance durchmachen, aber nicht als Glaube, sondern eben als eine Quelle der Philosophie.
Das würde sicherlich auch kulturelle Traditionslinien in der Geschichte von Erkenntnis und Denken erhalten, wenn auch auf eine stark säkularisierte Weise.
1Rudolf Bultmann “Neues Testament und Mythologie”, Chr. Kaiser Verlag, München 1985, S. 16.
2Vgl. Ebenda, S. 17.
3“A Short History of Chinese Philosophy” In: Feng Youlan “Selected Philosophical Writings”, China Books, San Francisco o. J., S. 150, Englisch.
4Siehe: Lukas 10, 29 ff.
5“A Short History of Chinese Philosophy” In: Feng Youlan “Selected Philosophical Writings”, China Books, San Francisco o. J., S. 152, Englisch.
6„Randnotizen zu: Friedrich Paulsen ´System der Ethik´“ (1917/1918) In: „Mao´s Road to Power“, Vol. I, M. E. Sharpe, Armonk (New York)/London 1992, S. 300, Englisch.